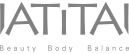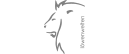Ablauf der Herzoperation von Ulrich Borggraefe
 Herzoperation Intensivstation - Bad Oeynhausen, Mai 1993 (Preface)
Herzoperation Intensivstation - Bad Oeynhausen, Mai 1993 (Preface)
Den
nachfolgend geschilderten Begebenheiten und Eindrücken liegen
Kurznotizen zugrunde, die ich allabendlich vor dem Einschlafen auf der
Pflegestation angefertigt habe. Die Idee hierzu kam mir erst sehr
spontan nach der Rückverlegung von der Intensivstation auf die
Pflegestation, so daß ich hierzu in meiner mir zu diesem Zeitpunkt
erreichbaren Umgebung gerade einmal einen stumpfen Bleistift und ein
Paper-Book fand. Die freien Seitenteile dieses Buchs ersetzten mir das
Schreibpapier.Die kurzen Schilderungen sind nicht durchweg chronologisch wiedergegeben, sondern gleichen mehr einer bunten Palette von Erlebnissen, ungeordnet und vielfach ohne inneren Zusammenhang. Dieses fehlende Geordnetsein entsprach allerdings auch meinem postoperativem, narkotisierten Zustand, in dem man versucht sich in einer fremden Umgebung zurecht zu finden.
Aufgrund von späteren Gesprächen mit Herzpatienten, die auf der gleichen Station lagen, habe ich den Eindruck gewonnen, daß mir die Erlebnisse und Eindrücke vergleichsweise intensiv in Erinnerung geblieben sind. Dies war dann auch der Grund warum ich in den Sommerferien 1993 meinen Laptop (Computer) bemüht habe, die folgenden Erinnerungen zu dokumentieren.
"Öffnung meines Herzens" ist - obwohl diese Ausführungen im Zusammenhang mit meiner Herzoperation stehen - nicht chirurgisch zu verstehen. Mich anderen Menschen gegenüber zu öffnen, und zwar mehr als ich dies vor meiner Operation vermochte, ist mir heute ein "Herzens-Anliegen". Es ist zugleich ein wichtiger Meilenstein auf meinem Weg der Lebensstiländerung.
Die Nacht vor der Operation
Als Operationstermin wurde bei meiner Einlieferung der 3. Mai 1993 festgelegt. Dieser Zeitpunkt wurde auch eingehalten, ganz im Gegensatz zu den Patienten, die ich in den Tagen vor meiner Operation auf den Fluren des Krankenhauses gesprochen habe, bei denen aufgrund dringender Herztransplantation der OP-Termin drei- und auch viermal kurzfristig verschoben wurde.Das Engelhemdchen
Das morgendliche Wecken erfolgte an diesem Tag bereits um fünf Uhr. Auf eine erfrischende Dusche mußte ich an diesem Morgen verzichten, da man mich am Tage zuvor bereits OP-fertig gemacht hatte, d.h. den Körper von allen Haaren befreit hatte. Die Morgenschicht verabreichte mir dann noch einmal eine Schlaftablette, die ihre Wirkung nicht verfehlte, denn bis auf einige belanglose Gespräche mit meinem Bettnachbarn und bis auf die Tatsache, daß es ein schöner, sonniger Montagmorgen war, kann ich mich an keine Besonderheiten mehr erinnern.Gegen 10 Uhr wurde mir das für Operationen obligatorische "Engelhemdchen", mein Nachbar nannte es wenig feinfühlend Totenhemd, von der Schwester angelegt. In dieser Aufmachung wurde ich dann in meinem Bett in den OP-Bereich gerollt. Auf der Grenze der weißen Krankenhauswelt (Pflegebereich) zur grünen Krankenhauswelt (OP-Bereich) lud man mich dann auf einen fahrbaren Tisch zur Vorbereitung auf die Narkose um und rollte mich dann in den OP-Vorbereitungsraum. Hier wurde ich mit grünen vorgewärmten OP-Tüchern abgedeckt. Die Wärme der Tücher tat mir gut.
Der Cocktail
Gut tat mir auch eine Prise Sauerstoff, die mir über eine angelegte Atemmaske verabreicht wurde. Dann wurde es hektisch, der Chefarzt der Amnestesie betrat den Raum. Er begrüßte mich, stellte sich kurz und korrekt vor und teilte mir mit, er würde mir nun einen Cocktail verabreichen.Zu diesem Zeitpunkt war ich durch mein inneres Abschalten bereits in eine große Letargie verfallen, so daß ich erst beim Ansetzen einer Spritze merkte, daß es sich bei besagtem Cocktail um die Spritze handelt, die vor der Narkose gegeben wird. So waren diese Worte und diese Handlungen auch die letzten Dinge, die ich vernahm. Den Worten folgt dann in meiner Erinnerung ein großes schwarzes Loch, das sich - zeitlich gesehen - bis zum Aufwachen in der blauen Krankenhauswelt , d.h. der Intensivstation, erstreckt.
Im blauen Salon
Auf der Intensivstation wurde ich vom Pfleger mit Worten begrüßt, die in etwa wie folgt lauteten: "Sie befinden sich hier im blauen Bereich. Die Operation ist gut verlaufen. Zur Zeit werden sie über die Herz-Lungen-Maschine beatmet und können wegen der Atemschläuche nicht sprechen. Ihre Frau ist über den guten Ausgang der Operation informiert."Wie mir meine Frau später bei Ihrem Besuch am nächsten Tag berichtete, erreichte sie der erlösende Anruf gegen 15 Uhr, so daß die Operation ungefähr drei bis vier Stunden gedauert hat.
Diese Worte des Pflegers, der sich mit dem Namen Hannes vorstellte, sind mir so gut in Erinnerung, da sie insbesondere die Nachricht enthielt, daß meine Lieben nun informiert sind. Mit der Bezeichnung "blauer Bereich" war die Intensivstation gemeint, in der alle Mitarbeiter blaue Berufskleidung tragen. Als ich diese Worte vernahm, mußte ich allerdings spontan an einen blauen Salon denken, bis ich mir über die Worte blauer Bereich im Sinne von Intensivstation klar wurde.
Die Sache mit der Uhr
Da ich beim Erwachen auf der Intensivstation natürlich meine Brille nicht auf hatte, hatte ich aufgrund meiner Kurzsichtigkeit große Schwierigkeiten beim Sehen. So kann ich mich z.B. weder an Gesichter des Pflegepersonals noch an die der Ärzte erinnern. Auch Details der Räumlichkeiten und der medizinischen Apparate, wie die Herz-Lungen-Maschine, habe ich nicht vor Augen.Um den Grad meiner Fehlsichtigkeit bildhaft zu machen, erwähne ich die große Wanduhr, die direkt in meinem Blickfeld an der gegenüberliegenden Wand hing. Was muß ich den Pfleger genervt haben, den ich immer wieder nach der Uhrzeit gefragt habe, der jedoch um meine Kurzsichtigkeit nichts wissen konnte. Als ich ihn dann kurz vor Schichtwechsel darum bat mir meine Brille zu reichen, sah ich seinen verständnisvollen Blick. Jetzt hatte sich für ihn die Sache mit der Uhr wohl aufgeklärt.
Befreiung von den Schläuchen
Zu den vielen Schläuchen, Meß- und Kontrollkabeln und sonstigen Strippen sei bemerkt, daß es eine unvorstellbar große Anzahl war. Nach meiner Erinnerung wurde ich zu diesem Zeitpunkt von fünf Schläuchen befreit, womit immerhin noch die gleiche Anzahl verblieb. Selbst an einen Schlauch zum Wasserlassen war gedacht. Ich erinnere mich deswegen so gut daran, weil ich dem Pfleger ein Kompliment gemacht habe, wie gekonnt er mir den selbigen herausgezogen hat.Zuvor waren mir bereits die schlimmsten Schläuche abgenommen worden, und zwar der durch den Mund eingeführte Beatmungsschlauch sowie der durch die Nase eingeführte Schlauch zur Vermeidung von Erstickung im Falle des Erbrechens. Der an die Herz-Lungen-Maschine angekoppelte Beatmungsschlauch war fest in den Schlund eingepreßt und verhinderte so jegliches Sprechen.
An diesem Schlauch muß ich bis gegen Mitternacht gehangen haben. Er verursachte die größten Schmerzen, die ich im "blauen Salon" durchgemacht habe. Zeitweilig kullerten mir vor Schmerzen die Tränen aus den Augen und zwar so, daß ich das Gefühl hatte, mein Kopfkissen sei naß vor Tränen. Insofern erschien mir die Befreiung von diesem Marterinstrument als der erlösenste Augenblick nach der OP.
Dies aber nicht nur deswegen, weil er mich von peinigenden Schmerzen befreite, sondern insbesondere, weil ich nunmehr wieder in der Lage war, zu sprechen bzw. mich mitzuteilen. Und mein Mitteilungsbedürfnis war groß. So wollte ich vor allem wissen, wann ich von diesem Folterschlauch befreit werde. Dies machte ich dem Pfleger durch Hinweis auf meine Tränen und auf die Uhr an der Wand deutlich.
Er gab mir zu verstehen, daß ich wohl bis gegen 21 Uhr über die HL-Maschine beatmet werden müsse, allerdings mit der Einschränkung, daß alles einen planmäßigen Verlauf nimmt. Genau dieser planmäßige Verlauf war mir nicht vergönnt, mit der Folge, daß ich um Mitternacht immer noch an der Herz-Lungen-Maschine angeschlossen war. Die Sauerstoffanreicherung im Blut erfolgte nicht so schnell wie erwartet. Dies merkte ich an den vielen Blutentnahmen, die zur Sauerstoffmessung ins Labor geschickt wurden, und zwar auch noch dann, als andere Patienten, die nach mir operiert wurden, bereits von ihren Schläuchen befreit waren.
Wie ich später aus dem bei Schichtwechsel mündlich vorgetragenen Bericht entnehmen konnte, wurde die ganze Angelegenheit auf eine falsche Anamnese zurückgeführt. Letztlich wurde mir dann aber auch in diesem Report bestätigt, daß der Patient durch seine aktive Mitarbeit in der Postphase (nach Beendigung der künstlichen Beatmung) diesen Rückstand wieder aufgeholt habe.
Der Traum von der ersten Tasse Kaffee
Des weiteren waren meine im Zustand des Erwachens noch narkotisierten Sinne beschränkt auf den Geruchssinn. Als markantestes Geruchserlebnis habe ich das Kaffee-Ereignis in Erinnerung. Es war beim Wechsel der Frühschicht, als mich der morgendliche Kaffeegeruch aus meinem dösenden Zustand holte. Den Becher, aus dem der wohltuende Duft entströmte, entdeckte ich in den Händen der die Frühschicht übernehmenden Schwester. Den Kaffee genüßlich schlürfend lehnte sie lässig an der Fensterbank und nahm den Bericht der Nachtschicht kopfnickend zur Kenntnis.Nicht daß ich ihr den Kaffee nicht gönnte! Zur Beurteilung meiner Situation muß man wissen, daß mir zu diesem Zeitpunkt eine Tasse Kaffee noch in unerreichbarer Ferne zu liegen schien. Dies um so mehr, als man mir zur Reduktion des Wasserhaushaltes im Körper bisher nach langem Bitten und Betteln gerade einmal einen kleinen Becher Eiswasser zugestanden hatte. Unerwartet schnell ging dann jedoch mein Kaffeewunsch in Erfüllung, indem mir drei Stunden später von besagter Schwester das Frühstück - nun bereits auf der Bettkante sitzend - serviert wurde.
Es begann in einer Sommernacht im sonnigen Torent
Das erste, was ich nach meinem Aufwachen in der Intensivstation akustisch wahrnahm, war die schmachtende Stimme eines Vico Torriani mit obigem Oldtimertext. Man stelle sich meine Situation der Orientierungslosigkeit beim Erwachen aus der Narkose vor. Ich brauchte eine schier endlose Zeit, um mich mittels dieser Informationen wieder in dieser Welt zurecht zu finden. Zunächst habe ich aber vergeblich über diese tiefsinnigen Worte nachdenken müssen, bis mir der Pfleger Hannes bei der Problemlösung hilfreich beistand. Mit ruhiger und kompetenter Stimme stellte er sich als Pfleger Hannes vor und verkündete mir, daß ich mich nun, nach erfolgreicher Operation auf der Intensivstation befände.Das Schlimmste ist überstanden, jetzt kann es nur noch bergauf gehen, ging es mir durch den Kopf. Frohlockend kam mir der Gedanke, daß mein Fall jetzt nicht mehr dazu geeignet sei, die Mortalitätsrate für fehlgeschlagene Herzoperationen zu beeinflussen. Nicht gerade feinfühlig prangte eine derartige Statistik mit grafischer Untermalung an der Wand der Pflegestation, gegenüber von meiner Zimmertür.
Der Herz-Lungen-Maschine anvertraut, machte ich mich gezielt auf die Ortung nach der Tonquelle, die mir da immer wieder klarmachen wollte, daß alles "im sonnigen Torent" begann. Die Suche konnte dann erfolgreich mit der Entdeckung eines Lautsprechers direkt über mir an der Zimmerdecke abgeschlossen werden.
Nachdem ich mich mit diesem unvermeidlichen Schicksal abgefunden hatte, ging mir durch den Kopf, daß es mit der Mitbestimmung der Patienten im Krankenhaus auch nicht zum Besten bestellt sein könne, denn schließlich hatte ich mit einem Schlauch im Hals auch nicht die geringste Chance, auch nur einen Pieps von mir zu geben, geschweige meine Veto-Stimme gegen diese Art von Musik, die mich wahrhaft nervte, zu artikulieren.
Der Kampf um den Sauerstoff
Nach der Operation wird der Patient auf der Intensivstation im Regelfall für fünf bis sechs Stunden ausschließlich über ein Beatmungsgerät beatmet. Danach wird die Maschine sukzessive auf Eigenatmung umgestellt, d.h. die unterstützende Funktion des Beatmungsgerätes wird bei zunehmender aktiver Atmung des Patienten gedrosselt.Das regelmäßige Arbeiten des Beatmungsgerätes beim Erwachen auf der Intensivstation hörte sich wie ein rhytmisch bedienter Blasebalg an. Als ich vom Pfleger dahingehend instruiert wurde, daß ich zunächst einmal über ein Gerät beatmet werde, habe ich mir Vorwürfe gemacht, daß ich mich vor der Operation nicht eingehender mit dieser Technik auseinandergesetzt habe. In diesem Moment begriff ich nur so viel, daß ich nunmehr ganz dieser Maschine ausgeliefert bin.
Über einen Schlauch wurde mir in einer bestimmten Zeiteinheit (etwa vier Sekunden) eine bestimmte Menge Sauerstoff ohne mein Zutun in die Lungen eingeblasen. Ich reagierte zutiefst verärgert, daß mir dieser Sauerstoff in nur rationierter Form zugeteilt wurde, denn nach meinem Gefühl war die Luftzufuhr bei weitem zu wenig. Alle Versuche, der Maschine mehr Sauerstoff abzuringen schlugen fehl. Warum muß gerade hier auf der Intensivstation an Sauerstoff "gespart" werden, dachte ich empört, um mich dann aber bald wieder mit der Vorstellung, daß diese Situation bereits tausende Patienten überlebt haben, zu beruhigen.
Gerade mit dieser Einsicht in das Unabwendbare abgefunden, stellte sich meine Problematik schon wieder anders dar. Die ruhigen Worte des Pflegers wiesen darauf hin, daß ich mich nunmehr an der Atmung aktiv beteiligen müsse. Langsam einatmen, langsam ausatmen, war nun die Devise. In dieser Situation des "Halbautomatikbetriebs" sah ich meine größte Chance, dem System mehr Luft abzuringen als mir in der vollautomatischen Gangart zustand.
Genüßlich zog ich den ersten Atemzug in meine Lungenflügel. Ich zählte 21, 22, 23, 24, dann machte es unverhofft klick und und mit der Sauerstoffzufuhr war es am Ende. Ich war entsetzt, wieder so wenig Sauerstoff! Dann überlegte ich cool: wenn dies mein eigener Beitrag zur Beatmung gewesen war, so stand mir der Beitrag der HLM noch zu. So also nicht, das muß ganz anders laufen!
Der Plan war geboren, mich an die optimale Aufteilung zwischen Eigen- und Fremdbeatmung heranzutasten. Mir war klar, daß dem Beatmungssystem ein Programm zugrunde liegt, das es nunmehr im Wege des trial and error zu analysieren und zu entschlüsseln galt, um es letztlich optimal zu nutzen. Konsequent verringerte ich nun meinen Eigenanteil, 21, 22 stop.
Und siehe da, mit dem Aussetzen meiner Atmung machte es wieder klick, dieses mal aber mit der Folge, daß mir eine Sonderportion Luft zugeteilt wurde. Nach mehrfachem Experimentieren war ich mir darüber im klaren, daß die Maschine von einem Zeitintervall von ca. vier Sekunden den Anteil übernahm, der nicht durch Eigenatmung genutzt wurde. Somit war es nicht möglich, sich durch eigene Atemaktivitäten Vorteile zu verschaffen. Die effektiveste Nutzung des Beatmungssystems bestand somit in einer Eigenatmung und einer Fremdbeatmung von jeweils zwei Sekunden. Damit war das Problem für mich gelöst.
Schwestern
Schwestern im Krankenhaus mag man oder man kann sie nicht ab. Vor Letzteren möchte man sich am liebsten unter der Bettdecke verstecken, wenn sie das Zimmer betreten. Hier soll jedoch von einer meiner Lieblingsschwestern in Bad Oeynhausen die Rede sein. Es war eine der vielen Nachtschwestern. Sie mochte mich wohl und machte mir während unserer mitternächtlichen Gespräche insbesondere auch vor der OP viel Mut. Ich mochte sie auch, hoffte aber bis zu meiner Entlassung schon gar nicht mehr auf ein Wiedersehen. Dann kam alles ganz anders.Am Abend vor meiner Entlassung trat sie unerwartet zur Tür herein und fragte routiniert nach meinen Wünschen. Ob sie mich wohl erkannt hat, fragte ich mich. Dann bemerkte ich zaghaft: "Auch mal wieder im Dienst?".
Ihr "Ja" klang etwas verunsichert, sie schien mich wieder zu erkennen, konnte mich aber noch nicht unterbringen. "Auf welchem Zimmer haben Sie gelegen ?" begann sie nun recherchierend. "Zimmer 624" war meine Antwort. Dann verschwand sie, um mir die obligatorische Flasche Wasser zu holen.
"Sie sind der Patient mit dem Wunsch nach einer starken Schlaftablette" stellte sie bei ihrer Rückkehr - noch immer ein wenig zögernd - fest. Ich bejahte und unser beider Problem war gelöst. Tatsächlich hatte ich sie vor meiner OP darum gebeten, mir eine Schlaftablette, die nicht in Ihrem Sortiment war, zu besorgen; was ihr mit gutem Willen und etlicher Mühe auch gelungen war.
Nachdem sie das Zimmer verlassen hatte, begriff ich, daß Schwestern in einem Krankenhaus wie diesem die Gesichter ihrer Patienten nicht sehen und sich schon gar nicht merken. Sie denken in Kategorien der Pflege, des Heilens und - wie sich hier zeigt - nicht zuletzt in Tabletten, Medikamenten und Medizin.
Wie könnte es auch anders sein!